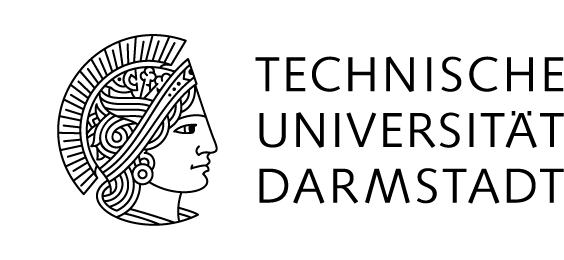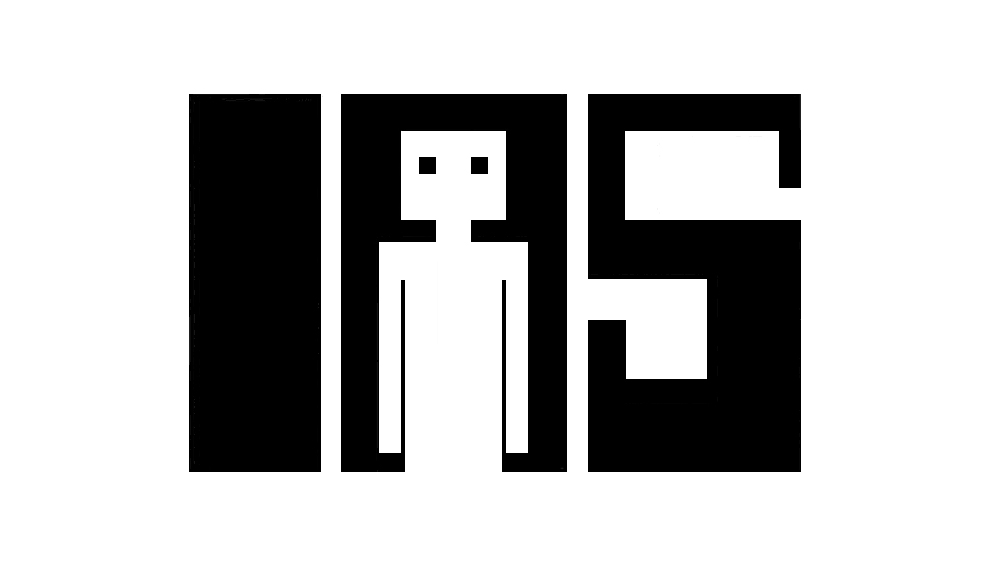Deutschlandfunk-Artikel ComputationalEngineering
"Verrechnet"
Sendereihe im Deutschlandfunk von Frank Grotelüschen
In einer neunteiligen Beitragsreihe widmet sich das Wissenschaftsmagazin "Forschung aktuell" jeweils Dienstags ab 16 Uhr 35 Rechenfehlern und den damit verbundenen kleineren oder sehr folgenreichen Konsequenzen. Denn auch Experten können sich im Zeitalter von Supercomputern schlicht verrechnen. Manchmal bleiben solche Rechenfehler über Jahre unentdeckt und können schwere Konsequenzen haben. Mit der Reihe "Verrechnet" geht "Forschung aktuell" den kuriosesten und folgenreichsten Rechenfehlern der letzen Jahrzehnte nach.
Zusammengekommen sind überraschende und ungewöhliche Irrtümer, die zeigen, welche Rolle die Mathematik heutzutage in allen Bereichen des Lebens spielt.
Der Börsencrash von Vancouver: Wie ein Rechenfehler die Finanzwelt durcheinander brachte
Die Mathematik bildet das Rückgrat von Naturwissenschaft und Technik. Und viele ihrer Erkenntnisse finden sich unmittelbar in der Wirtschaft wieder. Dort könnten Fehler jedoch folgenschwere Konsequenzen haben.
Montag, 28. November 1983. Die Finanzwelt reibt sich verwundert die Augen. Der Aktienindex der Börse von Vancouver vollführt einen dramatischen, geradezu mysteriösen Sprung. Am Ende des Freitags hatte er noch bei 524,811 Punkten gestanden. Doch nun, am Montagmorgen, steht die Anzeige plötzlich auf 1098,892. Eine glatte Verdopplung, ein unglaubliches Plus von über 100 Prozent! Was war passiert? Nun - die Geschichte beginnt ein gutes Jahr zuvor, im Januar 1982. Damals führte die Börse von Vancouver, auf der Penny-Stocks, also Billig-Papiere, gehandelt wurden, einen Aktienindex ein. Ein Aktienindex fasst die wichtigsten Papiere zusammen und gibt wie ein Barometer darüber Auskunft, ob die Börse rauf geht oder runter.
Das kann man sich vorstellen wie den Dax-Index: Das ist ein Durchschnittswert über die Kursentwicklung, die an der Börse stattfindet. Da möchte man sehen: Wie bewegt sich der Markt insgesamt,
sagt Jörg Liesen, Mathematiker an der Technischen Universität Berlin. Im Januar 1982 legten die Börsenchefs den Startwert für den Index fest auf einen Wert von genau 1000 Punkten. Dann wurde gehandelt und gefeilscht. Die Börse florierte recht anständig, die meisten Werte legten im Laufe der Monate zu. Doch seltsam - der Index fiel. Und zwar tiefer und tiefer, so stetig wie ein Jumbojet beim Landeanflug.
Er hat sich nicht von 1000 nach oben entwickelt, sondern sank immer tiefer. Nach einem Jahr hat man gedacht: Das kann irgendwie nicht sein! Da stand der Index ungefähr bei 520. Also ein Indexverlust von 48 Prozent! Und dann hat man Experten rangeholt, die sich mit der Index-Berechnung befassten.
Fachleute aus Toronto und Kalifornien wurden eingeflogen. Sie grübelten, analysierten, rechneten nach. Und dann, im November 1983, hatten sie den Fehler aufgespürt:
Jedes Mal, wenn sich ein Aktienkurs veränderte, was ungefähr 3000 Mal am Tag geschah, wurde der Index neu berechnet. Dann wurde der Index auf die vierte Nachkommastelle berechnet.
Aber, und jetzt kommt's:
Bei der Indexberechnung, immer wenn man den neuen Durchschnittswert bildete, hat man die vierte Nachkommastelle weggelassen. Man hat also nicht gerundet, sondern hat einfach weggeschmissen!
Ein simpler Rechenfehler - und ein ziemlich dummer dazu. Denn wie man richtig rundet, sollte eigentlich jedes Kind wissen, und nicht nur ein promovierte Mathematiker wie Jörg Liesen:
Ab 0,5 rundet man auf eins auf. Und darunter rundet man eben ab. Das lernt man eigentlich in der Schule!
Nun könnte man meinen, es sei doch ziemlich egal, ob ein Aktienindex bei der vierten Stelle hinterm Komma falsch gerundet wird. Schließlich beträgt der Fehler allerhöchstens 0,0005 - eine ziemlich mickrige Zahl. Nur: Der Index wurde ja 3000 Mal am Tag neu berechnet. Und dadurch konnte sich der Fehler hochschaukeln auf immerhin einen Punkt pro Handelstag. Über einen Zeitraum von zwei Jahren, also von Anfang 1982 bis Ende 83, hatte das fatale Auswirkungen, rechnet Jörg Liesen vor.
Es gibt ungefähr 20 Handelstage im Monat, also 240 Handelstage im Jahr. Nach zwei Jahren habe ich 480 Handelstage. Das ist dann das, was der Index verloren hatte - und zwar 48 Prozent.
Drei Wochen dauerte es, bis die Experten den Fehler behoben und den korrekten Index berechnet hatten.
Repariert wurde der Fehler einfach durch Einfügung der korrekten Rundung in die Software. Und der tatsächliche Index-Stand war dann rund 1100 - im Gegensatz zu den falsch berechneten 520.
Und so kam es, dass sich der Aktienindex von Vancouver binnen eines Tages auf einen Schlag verdoppelte. Doch die Börsianer hatten Glück. Große Auswirkungen hatte ihr Fauxpas nicht.
Anfang der 80er Jahre gab es noch nicht diese große Anzahl von Finanzderivaten und Optionen wie heute. Als der Fehler auftrat, diente der Index nur zur reinen Beobachtung des Marktes. Aber wenn es Optionen auf Indices gibt, oder Optionen auf diese Optionen, können solche Fehler katastrophale Folgen haben.
Das bedeutet: Würde ein Rechenfehler wie in Vancouver heute passieren - der internationale Börsenhandel müsste wahrscheinlich gestoppt und Abermilliarden von Aktienwerten, Optionen und Transaktionen neu berechnet werden. Ein Desaster für die Finanzwelt - und die Börsenmakler würden noch aufgeregter übers Parkett schreien, als sie es eh schon tun.
Runder Fehler - Das Versagen der Patriot-Abwehrrakete
Im Winter 1990/1991 vertrieben Truppen unter der Führung der USA den Irak aus dem besetzten Kuwait. Bei dieser Gelegenheit setzten die Amerikaner zum ersten Mal ihr Arsenal an Hightech-Waffen ein. Eine davon, die Abwehrrakete "Patriot" patzte allerdings ziemlich, und das aufgrund eines Rechenfehlers. 25. Februar 1991. Im US-Stützpunkt Dhahran in Saudi-Arabien schlägt eine irakische Scud-Rakete ein. Sie tötet 28 amerikanische Soldaten, 100 werden verletzt. Die Militärs sind perplex. Eigentlich hatten sie sich vor Scud-Angriffen in Sicherheit gewogen, denn die Kaserne war durch ein modernes Abwehrsystem geschützt, die Patriot-Rakete. Sie hätte rechtzeitig abheben und der Scud-Rakete entgegenfliegen sollen, um sie im Fluge abzuschießen. Doch das System hatte versagt - wie sich zeigen sollten wegen eines ziemlich simplen Rechenfehlers in der Steuersoftware des Abwehrsystems.
"Die interne Uhr von einem Steuerprogramm von so einer Rakete gibt die Zeit in Zehntel Sekunden an",
erläutert Christine Gräfe, Mathematikerin an der Freien Universität Berlin,
"das Steuerprogramm selbst aber rechnet in Sekunden. Also muss das umgerechnet werden."
Nun gut, wo liegt das Problem? Zehntel Sekunden in Sekunden umrechnen - das kann doch jedes Kind. Zum Beispiel:
"1 Zehntel Sekunde = 0,1 Sekunden."
Richtig.
"5 Zehntel Sekunden = 0,5 Sekunden."
Genau.
"10 Zehntel Sekunden = 1 Sekunde."
Und so weiter, und so fort. Für einen Computer aber ist dieses Umrechnen nicht so einfach. Schließlich rechnet ein Computer nicht wie wir im Dezimalsystem, also mit Zehnern, Hunderten und Tausendern. Nein, er rechnet in Bits, mit binären Zahlen, mit Nullen und Einsen. Das Problem: Bestimmte Zahlen lassen sich damit nur schwierig darstellen, sagt Christine Gräfe, zum Beispiel ein Zehntel, also 0,1. Gräfe:
""Wenn man sie darstellen möchte, dann gibt es einen Term, der heißt: 0.00011001100 und so weiter und so fort."
Also ein Bandwurm aus Nullen und Einsen, der ewig weitergeht und einfach nicht aufhört. Da aber ein Rechner mit unendlichen Zahlenfolgen nicht umgehen kann, schneidet er den Bandwurm einfach irgendwann ab. Bei der Patriot-Abwehrrakete passierte das nach der 24. Stelle. Das Resultat: ein Rundungsfehler. Gräfe:
"In diesem Fall war der Rundungsfehler ungefähr 9,5 mal 10 hoch -8. Das heißt dieser Rundungsfehler war sehr, sehr klein."
10 hoch -8 - eine Zahl mit sieben Nullen hinter dem Komma. Das ist in der Tat ziemlich winzig und sollte das Raketenabwehrsystem eigentlich nicht weiter stören. Aber nun kommt der entscheidende Fehler. Gräfe:
""Wenn das System sehr, sehr lange läuft, dann schaukelt sich dieser Rundungsfehler auf. Wenn dieses System 100 Stunden läuft, dann verrechnet es sich bereits schon um 0,34 Sekunden."
Und genau das war im Februar 1991 passiert: Der Patriot-Steuercomputer war schon rund 100 Stunden gelaufen, als sich die Scud-Rakete näherte. Gräfe:
""Wenn man bedenkt, dass die Geschwindigkeit einer Scud-Rakete ungefähr 6000 Stundenkilometer beträgt. Dann sind 0,34 Sekunden eine Auswirkung von einem halben Kilometer, der verfehlt wird."
Und diese Abweichung von 0,34 Sekunden beziehungsweise einem halben Kilometer führte dann dazu, dass die Patriot-Rakete gar nicht erst abgefeuert wurde, um die herannahende Scud-Rakete abzufangen. Gräfe:
"Das hätte vermieden werden können, wenn man die Systemzeituhr immer wieder zurückgesetzt hätte. Dann hätte man in dem Moment den Fehler klein halten können. Das wurde aber anscheinend nicht gemacht. Somit hat sich dieser Fehler aufgeschaukelt. Und somit kam es leider zu diesem Unglück."
Besonders tragisch: Schon zwei Wochen vor dem Vorfall hatte die israelische Armee festgestellt, dass das Patriot-System ungenau wird, wenn man das Steuerprogramm länger als acht Stunden ununterbrochen laufen lässt. Daraufhin hatten die US-Militärs die Software überarbeitet und das Update an alle Patriot-Stützpunkte geschickt. Nur: In Saudi-Arabien kam es am 26. Februar 1991 an - also einen Tag, nachdem die irakische Scud-Rakete eingeschlagen war. Mathematikerin Gräfe zieht aus dieser Geschichte die folgende Lehre: Traue nie voll und ganz den Rechenfähigkeiten einer Maschine:
"Selbst im Taschenrechner kann man kleine Aufgaben geben, wo einfach falsche Ergebnisse rauskommen. Also man sollte immer bedenken, wenn man mit Computern rechnet: Das ist nicht das A und O, der sagt nicht auf jeden Fall die Wahrheit. Sondern es könnte durchaus Fehler geben."
Justizirrtum durch Rechenfehler: Die Verurteilung der vermeintlichen Kindesmörderin Sally Clark
Vor einigen Jahren sorgte ihr Fall in England für Schlagzeilen. Aufgrund von Indizien war die Anwältin Sally Clark des Mordes an ihren beiden Kindern für schuldig befunden worden. Doch drei Jahre später, im Berufungsverfahren, sprach man sie frei. Der Grund: Das Urteil des ersten Verfahrens basierte auf einer falsche Anwendung statistischer Methoden. England, im Dezember 1996. Christopher Clark, elf Wochen alt, liegt tot in seinem Bettchen. Diagnose: plötzlicher Kindstod. Bald darauf, im November 1997, bekommen die Eltern Sally und Steve Clark wieder ein Baby. Doch auch Harry stirbt früh, im Alter von acht Wochen.
Dadurch ist sie unter Mordverdacht geraten...
...sagt Hans-Hermann Dubben, Statistik-Experte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Das Ganze wurde erhärtet durch ein statistisches Gutachten, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass so etwas auftreten kann.
Als Gerichtsgutachter fungiert Sir Roy Meadow, ein renommierter Facharzt für Kinderheilkunde. Den Schöffen präsentiert er eine Zahl, die höchst einleuchtend klingt.
Er hat aus epidemiologischen Studien hergeleitet: Die Wahrscheinlichkeit, dass in einer solchen Familie ein Kind am plötzlichen Kindstod verstirbt, ist eins zu 8500. Dann hat er sich gedacht: Das ist genauso wie beim Würfeln: Wenn ich einmal werfe, um eine Sechs zu bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel. Wenn ich zwei Sechsen hintereinander werfe, ist die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel multipliziert mit einem Sechstel - macht ein Sechsunddreißigstel.
Für den Fall Clark heißt das: Man nehme die Einzelwahrscheinlichkeiten von eins zu 8500 miteinander mal, dann erhält man die Wahrscheinlichkeit, dass der plötzliche Kindstod zufällig zweimal auftritt. Heraus kommt eine extrem kleine Zahl - eins zu 72 Millionen. Nicht zuletzt wegen dieser winzigen Wahrscheinlichkeit verurteilt das Gericht Sally Clark im November 1999 zu lebenslanger Haft. Zu Unrecht, meint Hans-Hermann Dubben. Denn:
Vom Gedankengang her ist das dasselbe, was dieser Gutachter Herr Meadow gemacht hat und vielleicht auch viele andere, die darauf hereinfallen: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich am nächsten Sonnabend im Lotto gewinne, ist ungefähr eins zu 14 Millionen - eine unglaublich kleine Wahrscheinlichkeit. Sie können sich fast drauf verlassen, dass es nicht eintreten wird. Sie können sich aber fast drauf verlassen, dass irgendjemand in der Bundesrepublik im Lotto gewinnt. Da ist fast jedes Wochenende jemand dabei. Und das liegt nicht daran, dass das ein Wunder ist.
Nein - der Grund ist ganz einfach, dass es viele Millionen Menschen sind, die am Wochenende Lotto spielen. Für den Clark-Prozess bedeutet das: Im Laufe der Jahre werden in Europa Abermillionen von Babys geboren. Da treten selbst unwahrscheinliche Ereignisse wie ein zweifacher plötzlicher Kindstod geradezu zwangsläufig auf. Die statistischen Rechenspiele von Gutachter Meadow - sie sind unbrauchbar, ja unzulässig, meint Dubben. Das zeigt auch ein anderes Beispiel.
Sie kommen in ein Zimmer. Da steht ein Scharfschütze - oder zumindest einer, der vorgibt, ein Scharfschütze zu sein. Sie sehen eine auf die Tapete gemalte Zielscheibe, und da sind zwei Einschusslöcher, und zwar ziemlich genau in der Mitte. Da könnte man erstmal denken: Na ja, das ist ein guter Schütze!
Nur: Eigentlich weiß man gar nicht, wie die beiden Treffer zustande gekommen sind. Vielleicht war es ja so:
Wenn der in dieses Zimmer hereingekommen ist, hat er wahllos irgendwo hin geschossen. Dann hat er mit einem Filzstift die Zielscheibe drum herum gemalt. Und dann hat er noch mal geschossen und getroffen. Er hat dann nicht zweimal getroffen, sondern nur einmal.
Also kein so erstaunliches Kunststück, nicht unbedingt ein Meisterschütze. Aber es könnte auch noch anders gewesen sein:
Sie nehmen so einen Scharfschützen, der stellt sich in dieses Zimmer und ballert 2000 Mal auf diese Wand. Und dann guckt er: Gibt es irgendwo zwei Einschusslöcher, die so dicht beieinander liegen, dass ich da eine Zielscheibe drum herum malen kann? Das macht er.
In diesem Fall steckt hinter den vermeintlichen Kunstschüssen nichts als der pure Zufall. Genauso kann es, meint Hans-Hermann Dubben, auch bei der vermeintlichen Kindsmörderin Sally Clark gewesen sein.
Es hat sich irgendwann die Königliche Gesellschaft für Statistik in England eingemischt und klargestellt, dass die Rechnung, die der Herr Meadow aufgestellt hat, eine Milchmädchenrechnung war.
Im Januar 2003 wird Sally Clark im Berufungsverfahren freigesprochen. Im März 2007 findet man sie tot in ihrer Wohnung auf - gestorben an einer akuten Alkoholvergiftung. Sie habe sich, so ihre Familie, von dem Justizirrtum nie erholt.
Die Suche nach Vulkan: Wegen falscher Berechnungen fahndeten Astronomen lange nach einem Planeten, den es gar nicht gibt
Nach der Degradierung von Pluto zum Zwergplaneten durch die Internationale Astronomische Union besteht unser Sonnensystem aus acht Planeten. Das war nicht immer so, denn wegen eines Rechenfehlers suchten Forscher im 19. Jahrhundert nach einem Planeten, den es gar nicht gab. Intermerkuriale Planeten heißen die bis jetzt noch nicht mit Sicherheit nachgewiesenen, sondern nur vermuteten Planeten, welche innerhalb der Merkurbahn um die Sonne laufen. Wenn solche Körper nicht allzu klein sind, so wird man sie, wenn nicht mit bloßem Auge, so doch durch das Fernrohr, zeitweilig wahrnehmen können.
Im "Lexikon der Astronomie" von 1882 waren sie ein topaktuelles Thema: Planeten, die noch näher um die Sonne kreisen als der Merkur. Vulkan, so sollte der größte dieser hypothetischen Himmelskörper heißen. Viele Astronomen des 19. Jahrhunderts waren derart fest von seiner Existenz überzeugt, dass sie jahrzehntelang nach ihm suchten. Ihre Überzeugung fußte vor allem auf einem Durchbruch, der die Fachwelt im Jahre 1846 erschüttert hatte - die Entdeckung des Neptun, des achten und äußersten Planeten. Zuvor hatte Uranus als Außenposten des Sonnensystems gegolten. Doch etwas stimmte nicht mit der Umlaufbahn von Uranus.
Und zwar stellte man etwa um 1820 fest, dass der Planet zunächst schneller war, als er nach der theoretischen Berechnung sein sollte. Und nach 1820 wurde er auf einmal abgebremst in seiner Bahn.
Sagt Eugen Willerding vom Argelander Institut für Astronomie der Universität Bonn. Das Herumeiern des Uranus - damals ein mysteriöses Rätsel für die Himmelsforscher.
Es gab verschiedene Hypothesen. Eine Hypothese war die: Es muss noch ein anderer Planet im äußeren Sonnensystem sein, der die Bahn von Uranus irgendwie stört.
Es war vor allem der französische Mathematiker Urbain Le Verrier, der einen neuen Planeten als Grund für die Abweichungen vermutete. Mit den Gleichungen der Himmelsmechanik, also dem Newtonschen Gravitationsgesetz, konnte er die Bahn des neuen Planeten verblüffend genau berechnen. Und tatsächlich: Kurze Zeit später fand man Neptun fast genau dort, wo ihn Le Verrier prophezeit hatte. Der erste Planet, der nicht durch bloßes Herumsuchen entdeckt wurde, sondern durch eine gezielte Voraussage. Ein Triumph der Mathematik. Angestachelt durch diesen Erfolg hielt Le Verrier nach weiteren Kandidaten Ausschau.
Er hat natürlich jetzt danach gesucht, ob es noch einen anderen Planeten im Außenbereich gibt. Aber da gab es zunächst keine Hinweise. Aber dann hat man festgestellt, dass die Merkurbahn sich nicht genau nach den Newtonschen Gesetzen bewegte.
Merkur umkreist die Sonne auf einer Ellipsenbahn. Die Achse dieser Bahn dreht sich im Laufe der Zeit - und zwar pro Jahrhundert um 42 Bogensekunden schneller als es die Himmelsmechanik zu erklären vermochte. Da dürfte also wieder ein unbekannter Planet im Spiel sein, dachte sich Le Verrier - ein Planet, der noch dichter um die Sonne kreisen sollte als Merkur. Vulkan, so nannte Le Verrier den hypothetischen Trabanten - und trat 1859 mit seiner Voraussage einen astronomischen Goldrausch los. Überall auf der Welt wurden die Teleskope zur Sonne gerichtet. In deren Nähe nämlich vermutete man Vulkan.
Noch vor Ende 1859 machte der Arzt Lescarbault in Orgères im Departement Eure-et-Loire die Mitteilung, dass er bereits 26. März 1859 einen scharf begrenzten schwarzen Fleck in Zeit von 1 Stunde 17 Minuten vor der Sonnenscheibe habe vorübergehen sehen, dass aber die Hoffnung, den neuen Planeten noch einmal zu beobachten, ihn veranlasst habe, so lange zu schweigen.
Auch andere Astronomen, etwa der Quedlinburger Pfarrer Johann Heinrich Fritsch oder ein britischer Ingenieur namens Lummis, berichteten von verdächtigen Flecken, die sie vor der Sonne haben vorüberziehen sehen. Und manche versuchten, Vulkan während einer Sonnenfinsternis dingfest zu machen. Letztlich aber entpuppten sich die Erfolgsmeldungen allesamt als Fehlalarm.
Es war entweder ein Sonnenfleck. Oder es waren vielleicht auch Kometen oder Bruchstücke von Kometen, die man gesehen hat.
Um 1900 ließ der Beobachtungsdrang der Astronomen spürbar nach. Doch die fehlenden 42 Bogensekunden der Merkurbahn blieben ein Rätsel. Gelöst wurde es erst durch das wohl größte Physikgenie aller Zeiten.
Dann kam plötzlich Albert Einstein, der eine alternative Gravitationstheorie entwickelt hat, eine Weiterentwicklung der Newtonschen Theorie. Er hat 1916 genau die Arbeit herausgebracht, die mit einem einzigen Schlag diese zusätzlichen 42 Bogensekunden pro Jahrhundert mit einer einzigen Formel erklären konnte.
Vereinfacht gesagt, ist die Gravitationswirkung der Sonne auf den Merkur derart gewaltig, dass sie Raum und Zeit buchstäblich krümmt. Und genau diese Raumkrümmung gibt der Merkurbahn einen zusätzlichen Push, der allein mit Einstein zu verstehen ist. Le Verrier hatte also im falschen Modell gerechnet, mit der Newtonschen Himmelsmechanik. Er hat sich auf Gleichungen verlassen, die für Merkur schlicht und einfach nicht gelten. Ein Fehler, der eine Generation von Astronomen auf die falsche Fährte geschickt hat. Le Verrier aber sollte sein Scheitern nicht mehr erleben.
Le Verrier hatte die Frage der intermerkurialen Planeten zur Sprache gebracht und glaubte, die Beobachtungen von Fritsch, Lescarbault und Lummis auf ein und denselben Körper beziehen zu dürfen. Der Tod rief ihn indessen 23. September 1877 ab, ohne dass seine Hoffnung auf Wiederauffindung des vermuteten Planeten erfüllt worden wäre.
Die schwankende Millennium-Brücke von London: Fehlberechnung ließ Bauwerk in Schwingungen geraten
Die Millenium Bridge in London gilt als eine der elegantesten Brückenkonstruktionen der Welt, entworfen vom Büro des Stararchitekten Sir Norman Foster. Doch drei Tage nach der Einweihung im Juni 2000 wurde sie bereits wieder gesperrt, weil die Fußgänger sie ins Schwanken gebracht hatten. Später kam heraus, dass ein mathematischer Fauxpas die Ursache der Panne war. "For the first time since Tower Bridge was built over a hundred years ago, the Thames has a new crossing - the Millennium Bridge."
Auf dem Werbevideo erstreckt sie sich elegant von einem Themse-Ufer zum anderen, verbindet die St.-Pauls-Kathedrale mit der Tate Gallery of Modern Art - die Millennium Bridge, die erste neue Themse-Brücke seit 1894, als die Tower Bridge eingeweiht wurde. Stararchitekt Norman Foster hatte die Millennium Bridge gestaltet - eine futuristische Fußgängerbrücke, 325 Meter lang, höchst elegant, nahezu fragil. Ihre Eröffnung am 10.Juni 2000 lockte die Massen an. Jeder wollte als erster über das Wunderwerk spazieren. Tausende drängten sich auf die Brücke. Doch dann:
"We had to witness…"
Pat Dallard vom Ingenieurbüro Arup, verantwortlich für die Konstruktion.
"Wir mussten mit ansehen, dass sich die Brücke ganz anders verhielt als geplant. Wir hatten viel Arbeit in die Konstruktion gesteckt und waren uns sicher, alles im Griff zu haben. Doch dann geschah etwas, mit dem wir nie und nimmer gerechnet hätten."
Die Brücke fing an zu wackeln. Sie schlingerte von rechts nach links - fast wie eine Schlange, die sich über den Boden windet.
"Es war noch nicht richtig gefährlich. Aber es war schon so, dass die Schwingungen sich so stark aufgeschaukelt haben, dass man schon Angst bekam",
sagt Volker Mehrmann, Mathematikprofessor an der TU Berlin. Derart heftig wankte die Millennium Bridge, dass sich viele der Fußgänger ans Geländer klammern mussten, um nicht auf die Nase zu fallen. Die Brücke war also nicht sicher, und sie wurde zwei Tage nach ihrer Eröffnung wieder gesperrt. Die Ingenieure standen vor einem Rätsel. Sie wussten zwar dass marschierende Soldaten eine Brücke dazu bringen können, heftig auf- und abzuschwingen, also vertikal - und zwar wenn die Schrittfrequenz der Soldaten mit der Eigenfrequenz der Brücke übereinstimmt. Dann nämlich gibt es eine Resonanz, und die Schwingung kann sich gefährlich aufschaukeln. Doch dass eine Brücke auch horizontal, also hin- und herschwingen kann, das war Dallard und seinen Leuten neu:
"Außerdem beobachteten wir etwas sehr Bizarres: Das Schwanken hing auf sonderbare Weise von der Zahl der Leute ab, die gerade auf der Brücke waren. Bis zu einer bestimmten Anzahl von Fußgängern war sie noch stabil. Doch nur zehn Leute mehr, und plötzlich setzte das Schwanken ein."
Dann endlich, nach Monaten des Analysierens und des Testens, war der Grund gefunden. Mehrmann:
"Es gab eine Schwingung, die quer zur Fahrbahn in der Richtung der Themse läuft. Die ist ignoriert worden. Und die wird in den meisten Gebäuden ignoriert, weil die normalerweise so klein ist, dass man sie wirklich ignorieren kann."
Nur: Die Millennium Bridge ist keine gewöhnliche Konstruktion, sagt Volker Mehrmann. Sie hat ein höchst eigenwilliges Design.
"Das ist eigentlich wie eine Hängebrücke. Die Hängeteile sind nur seitwärts gekippt."
Diese gekippten Hängeseile haben das Hin- und Herschwingen der Brücke offenbar begünstigt. Hinzu kam, dass die Fußgänger dieses Schwingen unbewusst verstärkten: Um das Schwanken auszugleichen, verfielen sie kollektiv in eine Art Seemannsgang: breitbeinig und fast ein wenig torkelnd. Und das heizte die Schwingung zusätzlich an - ein fatales Wechselspiel. Genau diese Prozesse hatten die Ingenieure bei ihren statischen Berechnungen im Computer unterschätzt und schlicht unter den Tisch fallen lassen. Mehrmann:
"Wir gehen einfach in Designs, die mit den normalen, klassischen Erfahrungen nicht mehr erfahrbar sind. Und dann verlässt man sich oft darauf, dass die Dinge noch so sind, wie wir denken, dass sie sind. In Wirklichkeit hätten wir ein neues Modellierungskonzept entwickeln müssen."
Und wie wurde der Fehler ausgebügelt? Nun - die Ingenieure mussten die Brücke versteifen und 91 zusätzliche Stoßdämpfer einbauen - zu Kosten von rund fünf Millionen Pfund. Im Februar 2002 konnte das Bauwerk dann endlich wieder eröffnet werden. Und seitdem lässt sich - wie von Norman Foster geplant - stilvoll über die Themse flanieren.
"You're free from the elements. There's a movement of the river, the sound of the water, the traffic in the background. It's a unique combination."
Der Verlust des "Mars Climate Orbiter": Wie eine Marssonde dem Einheiten-Chaos zum Opfer fiel
Wer in den USA einkauft, sollte sauber rechnen, denn schnell schleichen sich Fehler in der Konvertierung von Unzen, Gallonen oder Meilen ein. Sehr viel fataler kommt es indes, wenn davon eine wertvolle Raumsonde betroffen ist. Mars, der Rote Planet. Ein Nachbar der Erde - und ihr in vielerlei Hinsicht ziemlich ähnlich. Die Planetenforscher sind seit jeher von ihm fasziniert und schicken immer neue Sonden und Roboter zum Mars, um ihn bis ins letzte Detail zu erkunden: Gibt es dort Wasser - oder gar Leben? Und: Was für ein Klima herrscht eigentlich auf dem Mars? Denn:
Der Mars gehört zu den Planeten, die eine Atmosphäre haben.
Sagt Professor Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof.
Die Atmosphäre von Mars ist natürlich nicht so dicht wie die von der Erde, sondern nur ungefähr nur ein Hundertstel. Sie ist auch anders zusammengesetzt. Aber sie ist da.
Und wo eine Atmosphäre ist, gibt es auch ein Klima - und damit auch Klimakatastrophen.
Wir wissen, dass es auf dem Mars in regelmäßigen Abständen passiert - und zwar grundlegende Klimakatastrophen. Und das war natürlich ein Ziel, das zu erforschen. Aber dazu muss man erst mal verstehen: Wie verhält sich diese Atmosphäre überall auf dem Mars? Und dazu muss man sie natürlich erst mal untersuchen.
Also schickte die Nasa am 11. Dezember 1998 eine Rakete zum Roten Planeten. An Bord: der Mars Climate Orbiter. Ein Satellit, der den Mars auf einer Umlaufbahn umkreisen sollte.
Dann sollte er die Atmosphäre mit Spezialsensoren vermessen, gucken: Wo ist sie am dichtesten, wo ist sie am wenigsten dicht? Und dann sollte er auch auf der Oberfläche nachschauen: Sieht man Spuren von Klimaänderungen? Und daraus kann man natürlich auch ablesen, was in Vergangenheit passiert ist.
Der Start klappte wie geplant, auch der neun Monate lange Flug. Am 23. September 1999 hatte der Climate Orbiter sein Ziel erreicht. Doch um nicht am Mars vorbeizufliegen, musste er abbremsen. Dazu nutzte die Sonde einen raffinierten Trick:
Ich nehme die Mars-Atmosphäre und fliege immer an der oberen Atmosphäre vorbei. Jedes Mal bremst mich die Atmosphäre, und ich werde dann immer langsamer. Dann kann ich mich mit relativ wenig Energie vom Mars einfangen lassen.
Man muss zwar aufpassen, dass die Sonde beim Bremsen nicht zu tief in die Atmosphäre eintaucht. Sonst droht sie zu verglühen. Aber bei älteren Missionen hatte dieses Manöver funktioniert. Doch als der Climate Orbiter nach dem Abbremsen wieder aus dem Funkschatten des Mars austreten sollte, herrschte Funkstille. Der Kontakt war abgebrochen, die 200 Millionen Dollar teure Sonde war verloren. Sie hatte sich dem Mars nicht wie geplant bis auf 150 Kilometer genähert, sondern bis auf 57 Kilometer. Hier ist die Atmosphäre bereits relativ dicht, und der Orbiter wurde durch die Hitze zerstört. Die Ursache des Navigationsfehlers war bald gefunden - und ziemlich peinlich:
Man hat die europäischen Maßeinheiten von Metern und Kilometern. Man hat aber auch im amerikanischen Gebrauch die Einheiten Fuß und Meile. Und die sind natürlich unterschiedlich. Wenn jetzt der eine mit den internationalen Einheiten Metern und Kilometern, die weltweit anerkannt sind, rechnet, und der andere mit Fuß und Meilen, ist da ein Fehler, der nicht vernachlässigbar ist. Das kann bedeuten, dass Sie plötzlich bei so einem gefährlichen Manöver näher dran sind als Sie gedacht haben.
Konkret war es so: Die Nasa hatte mit Metern und Kilometern gerechnet, so wie international üblich. Der Hersteller Lockheed Martin dagegen hatte die Navigationssoftware in Zoll und Fuß ausgelegt, also in amerikanischen Einheiten. Aufgefallen ist das niemandem. Als Folge wurde der Kurs der Sonde falsch berechnet. Sie kam dem Mars zu nah, ging verloren - und der Rest der Welt schüttelte verwundert die Köpfe, sagt Ralf Jaumann.
Ich denke, dass es in den europäischen Kontrollzentren bei der Esa durchaus ein Schmunzeln gab - und ein kleines bisschen eine beruhigte Sicherheit, dass in Europa dieser Fehler nicht passieren kann. Heißt nicht, dass nicht andere Fehler passieren können. Aber der kann mit Sicherheit nicht passieren.
Denn Europa rechnet - zumindest in Wissenschaft und Industrie -konsequent im Internationalen Einheitensystem - also in Metern, Kilogramm und Sekunde. Und gab es einen Ersatz für den Climate Orbiter? Nun - nicht direkt. Aber die meisten Fragen, denen er nachgehen sollte, die Fragen nach dem Marsklima, sind inzwischen durch andere Missionen beantwortet.
Die fehlerhafte Definition des Meters: Wie eine falsche Berechnung das Urmaß veränderte
95 Prozent aller Menschen benutzen das Metermaß heute. Früher hatte indes jedes Land, zum Teil sogar jede Stadt ein eigenes Längenmaß - höchst unpraktisch, wollte man überregional Handel treiben. Das sollte sich mit Einführung des Meters ändern, doch dabei blieben Fehler nicht aus. Paris, im Juni 1792. Zwei der besten Astronomen Frankreichs, Jean Delambre und Pierre Méchain, machten sich - bepackt mit allerlei wissenschaftlichen Präzisionsinstrumenten - zu einer spektakulären Expedition auf. Der eine zog nach Norden, Richtung Dünkirchen. Der andere gen Süden, nach Barcelona. Ihre Mission:
Die beiden Astronomen wurden mitten während der Französischen Revolution ausgesandt, um präzise zu messen, wie groß der Erdball ist. Daraus sollte eine neue Maßeinheit abgeleitet werden - der Meter. Er sollte genau der zehnmillionste Teil jener Entfernung sein, die zwischen Nordpol und Äquator liegt...
...erzählt Ken Alder, Historiker und Buchautor von der Northwestern University in Chicago. Um eine präzise Definition für den Meter zu finden, sollten Delambre und Méchain die Strecke zwischen Dünkirchen und Barcelona möglichst genau vermessen. Dazu bedienten sie sich einer Methode namens Triangulation. Sie ist noch heute jedem Landvermesser vertraut.
Das Grundprinzip ist simpel: Die Forscher mussten auf hohe Türme oder Berge steigen und dort mit ihren Instrumenten feststellen, in welchen Winkeln andere Türme oder Berge zu sehen waren. Am Ende konnten sie mit Hilfe der Geometrie sowie einigen wenigen Entfernungsmessungen ausrechnen, wie groß die Gesamtdistanz war.
Eigentlich sollte die Expedition nach sieben Monaten abgeschlossen sein. Am Ende dauerte sie sieben Jahre. Schließlich herrschte im Lande die Revolution!
Wenn die Herrschaften einen Kirchturm bestiegen und dort mit ihren Vermessungsinstrumenten hantierten, hielt man sie oft für Spione oder Konterrevolutionäre. Oder die Kirchtürme, die sie nutzen wollten, waren kurz zuvor von den Revolutionären abgerissen worden.
Doch 1799, aller Hemmnisse zum Trotz, war die Mission erfüllt. Jetzt konnte der Meter definiert werden. Nur:
Heute wissen wir, dass Delambre und Mèchain bei der Definition des Meters um etwa 0,2 Millimeter danebenlagen. Das entspricht der Dicke von zwei Blatt Papier.
Also: Der Meter ist eigentlich zu kurz, um 0,2 Millimeter. Mittlerweile weiß man, dass die Strecke vom Nordpol zum Äquator nicht zehn Millionen Meter misst, sondern 2000 Meter mehr. Die Diskrepanz hat zwei Gründe. Zum einen unterlief Méchain ein Messfehler, als er in Barcelona mit Hilfe astronomischer Beobachtungen den Breitengrad bestimmte. Zum anderen machten die Forscher bei der Datenauswertung einen mathematischen Fehler, und zwar als sie das Resultat ihrer Messung - die Distanz zwischen Dünkirchen und Barcelona - hochrechneten auf die Entfernung vom Nordpol zum Äquator.
Damals wussten die Wissenschaftler zwar schon, dass die Erde keine perfekte Kugel ist. Sondern sie ist an den Polen abgeflacht. Doch dann kam bei der Datenanalyse heraus, dass die Erdoberfläche keineswegs so glatt war wie erwartet. Nein, die Erde ist geradezu verbeult. Das Problem: Delambre und Méchain wussten nicht, wie sie damit korrekt umzugehen hatten - und machten es deshalb falsch und ungenau. Ironie der Geschichte: Die Methode, wie man eine Kurve mathematisch korrekt an die Beobachtungsdaten anpasst, wurde bereits wenige Jahre später entwickelt.
Doch da war es schon zu spät. 1799 wurde der Meter ein- für allemal festgelegt, ward der erste Urmeter aus Platin gegossen - und mit ihm der Fehler von 0,2 Millimetern. Dieser Fehler besteht bis heute - auch wenn der Meter inzwischen nicht mehr durch einen Platinstab festgelegt ist, sondern über die Lichtgeschwindigkeit definiert wird: und zwar als die Strecke, die das Licht im Vakuum in einer ganz bestimmten Zeit zurücklegt. Wenn also bei Olympia der Sieger des 10.000-Meter-Rennens über die Ziellinie hetzt, sollte man im Hinterkopf behalten, dass er eigentlich noch zwei Meter mehr hätte laufen müssen.
Der Zusammenbruch der Sleipner-Plattform: Wie eine Bohrinsel durch einen Rechenfehler einstürzte
Weil die damaligen Rechner die nötige Datenmenge zur Konstruktion nicht verarbeiten konnten, zerbrach die Bohrinsel Sleipner A.
In der Nordsee stehen fast 500 Bohrinseln, auf ihnen arbeiten mehr als 100.000 Menschen. Um den Naturgewalten zu trotzen, müssen sie extrem stabil konstruiert werden. An einem Augusttag des Jahres 1991 kam es dann zur Katastrophe, als die Bohrinsel Sleipner A zusammenbrach – und zwar wegen eines Rechenfehlers.
150 Kilometer vor der Küste Norwegens. Der Hubschrauber fliegt auf eine Bohrinsel zu – ein stählernes Monstrum, groß wie ein Fußballfeld. 40 Meter über der Nordsee ruht es auf vier mächtigen Betonstelzen. Sleipner A, so heißt die Plattform. Tag für Tag fördert sie gewaltige Mengen an Erdgas. Doch ihr Bau in der frühen 90er Jahren stand unter keinem guten Stern.
"Die erste Konstruktion, der erste Bau, ist bei der Testbelastung gebrochen und gesunken,"
erzählt Roman Unger, Mathematiker an der Technischen Universität Chemnitz. Was war passiert? Nun – am 23. August 1991 war der erste Bauabschnitt von Sleipner A fertig, die vier Betonpfeiler und der Unterbau der Plattform. Die Ingenieure wagten einen Belastungstest. Doch plötzlich ertönte ein lautes Dröhnen und Krachen: Die Betonstruktur brach in sich zusammen, die Plattform versank in den Fluten. Zum Glück war niemand auf dem Rohbau, es gab weder Tote noch Verletzte. Die Ursache für dieses Missgeschick hat mit einem mathematischen Verfahren zu tun, das im Ingenieurswesen schon lange zum Standard gehört – der Finite-Elemente-Methode.
"Das ist eine sehr weit anwendungsfähige Methode der numerischen Mathematik. Die kann nicht einfach mit Bleistift und Papier gelöst werden. Sondern dazu braucht man Rechentechnik. Dazu braucht man numerische Verfahren, um eine Lösung zu finden."
Die Finite-Elemente-Methode ist eine Art virtueller Belastungstest. Konkret funktioniert sie so: Um herauszufinden, ob ein bestimmtes Bauteil – sagen wir der Betonpfeiler einer Bohrinsel – stabil genug ausgelegt ist, bilden ihn die Ingenieure als dreidimensionales Modell im Computer nach. Dieses 3D-Modell unterteilen sie in lauter kleiner Kästchen, finite Elemente genannt. Danach startet die Simulation. Dabei wirken auf den Modellbetonpfeiler virtuelle Kräfte ein. Der Computer rechnet nun für jedes Kästchen einzeln aus, welchen Beitrag es zur Belastung liefert, den der Betonpfeiler zu ertragen hat. Das Resultat:
"Sie erhalten aufgrund dieser Berechnungen in diesen kleinen Kästchen eine Näherung der auftretenden Spannungen und Verformungen des Bauteils. Und Sie wissen: Anhand von Materialeigenschaften sind diese Spannungen für dieses Material zulässig, oder sie sind zu hoch, und es wird zum Bruch führen."
Aber Vorsicht, warnt Unger. Die Methode hat ihre Grenzen. Schließlich handelt es sich um eine Näherungsverfahren. Das Problem:
"Sie können ja nicht beliebig viele solcher finiter Elemente nehmen. Sondern Sie haben eine gewisse Größe, die Sie in den Rechner packen können. Und ab gewissen Größen schafft es Ihr Computer nicht mehr, das zu berechnen, weil es einfach zu aufwändig wird."
Genau das betraf auch die Konstrukteure der Sleipner-Bohrinsel in den frühen 90ern. Mit den damals verfügbaren Computern konnten sie nur ein relativ grobes Kästchenraster verwenden, und das ging auf Kosten der Genauigkeit. Außerdem mussten sie einige der Größen, die in die Simulation eingingen, schätzen – eine weitere Fehlerquelle. Die Folge:
"Bei Sleipner A sind Scherspannungen unterschätzt worden. Die wirklichen Scherspannungen in diesen Betonfundamenten waren um einiges größer, es war ein Fehler von 47 Prozent, als die Scherspannungen, die die Finite-Elemente-Berechnung geliefert hat."
Infolge ihrer Fehlberechnung legten die Ingenieure die Betonwände der Pfeiler viel zu schwach aus. Als dann beim realen Belastungstest die Nordsee gegen die Pfeiler drückte, wurden die Scherkräfte, also die von der Seite angreifenden Kräfte so groß, dass der Beton brach und die Plattform sank. Der Schaden: rund 700 Millionen Dollar. Missgeschicke wie dieses könnten vielleicht vermieden werden, wenn die Ingenieure enger mit den Mathematikern zusammenarbeiten würden, meint Roman Unger.
"Ich finde, es muss dort eine gute Zusammenarbeit bestehen. Grundlagenforschung nützt nichts, wenn sie nie die neuen Methoden für den Anwender zur Verfügung stellt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ungünstig, wenn auf der Anwendungsseite nur mit Software gearbeitet wird und dieser einfach blind vertraut wird, ohne ein Feedback zum Entwickler dieser Programme zu haben."
Der norwegische Energiekonzern Statoil ließ die versunkene Plattform übrigens bald nach dem Vorfall wieder heben, rechnete die Belastung mit verbesserter Software noch einmal durch und stattete die Plattform mit vier deutlich stabileren Betonpfeilern aus. 1993 ging Sleipner A in Betrieb. Heute arbeiten hier 240 Leute und holen pro Tag 22 Millionen Kubikmeter Erdgas aus dem Meeresgrund.
Der Absturz der Ariane 5: Ein fataler Rechenfehler verursachte die Katastrophe des Esa-Flaggschiffes
Der Jungfernflug der ersten Ariane am Heiligabend 1979 war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Dennoch lief in der fast 30-jährigen Geschichte längst nicht alles glatt: Denn im Sommer 1996 endete der Erstflug der Ariane 5 unmittelbar nach dem Start. Die Ursache war eine simple Fehlkalkulation.
"Stellen Sie sich vor, Sie organisieren eine Party und haben für Ihre Gäste eine gewisse Anzahl an Getränken zur Verfügung."
Christine Gräfe, Mathematikerin an der Freien Universität Berlin.
"Die Gäste kommen, die Party ist ein voller Erfolg. Bei der nächsten Party denken Sie sich: Na super, das mach’ ich genauso: Ich werde wieder genauso viel Getränke zur Verfügung stellen. Diesmal kommen aber mehr Gäste! In dem Moment reicht es nicht aus."
Der Sekt ist alle, der Wein ist aus, nicht mal mehr ein Fläschchen Bier ist mehr zu haben. Die Party wird zum Flop, denn der Gastgeber hat sich verkalkuliert: Er hat genauso viel Getränke wie bei seiner letzten Party gekauft, obwohl diesmal viel mehr Gäste gekommen sind. Dieser Fauxpas ist vor zwölf Jahren der Europäischen Weltraumorganisation Esa passiert – und zwar nicht bei der Organisation ihres Jahresempfangs, sondern bei der Fortentwicklung ihrer Trägerrakete Ariane.
4. Juni 1996, der Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Die Ariane 5, das Nachfolgemodell der Ariane 4, steht zu ihrem Erstflug bereit. Die Triebwerke zünden, die Rakete hebt ab. Doch dann, nach 30 Sekunden:
"Kurz, nachdem sie gestartet ist, ist sie vom Kurs abgekommen und explodiert. Und man wusste zunächst erst mal nicht, wieso. Eigentlich war alles gut geplant. Das Vorgängermodell Ariane 4 lief ja auch sehr gut."
Die Ariane 5 ist stärker und schneller als ihre Vorgängerin und kann dadurch mehr Nutzlast in den Orbit bringen. Das Bordcomputer-System aber ist bei beiden Versionen baugleich. Es hat sich in der Ariane 4 bewährt, deshalb haben es die Raketenbauer übernommen. Doch wie sich später zeigen soll, unterläuft den Experten dabei ein entscheidender Fehler. Christine Gräfe:
"Man muss sich das Ganze so vorstellen, dass gewisse Daten von einem Computer zu dem anderen übergeben werden, diese Zahlen aber teilweise umgerechnet werden müssen, aufgrund der Speicherungsmöglichkeiten im Computer."
Während des Fluges wertet der Bordrechner auch die Daten für die Geschwindigkeit aus. Dabei muss er so genannte Gleitkommazahlen umformen in ganzzahlige Werte. Bei der Ariane 4 hat dieses Umwandlung stets geklappt, und zwar wie am Schnürchen.
"Jetzt hat man jedoch beim Nachfolgemodell Ariane 5 nicht beachtet, dass die Ariane 5 eine schnellere Rakete ist. In dem Moment sind die Daten, die übermittelt worden sind, höhere Zahlen gewesen. Und diese Zahlen haben in den Bereich, den der Computer auffassen konnte, nicht mehr reingepasst."
Die Folge: ein Überlauf im Speicher des Bordrechners – etwa so, als wenn bei einer vollen Badewanne das Wasser überläuft. Durch diesen Datenüberlauf ist der Bordrechner der Ariane 5 hoffnungslos überfordert.
"Ein Computer weiß nicht, ob diese Daten Sinn machen oder nicht. Das heißt, er hat sie weiterinterpretiert als Flugdaten. Die waren natürlich völliger Schwachsinn. Für den Computer bedeutete das aber: Oh mein Gott, die Rakete liegt völlig falsch."
Um die vermeintliche Schieflage auszugleichen, lässt der Rechner die Schubdüsen bis zum Anschlag schwenken. Dadurch zerren gewaltige Kräfte an der Rakete, sie beginnt auseinander zu brechen. Noch bevor die Bodenkontrolle eingreifen kann, löst die Bordelektronik die Selbstzerstörung aus. Die Ariane 5 explodiert – und zwar wegen eines simplen Kalkulationsfehlers ähnlich wie bei unserem Party-Gastgeber, der zu wenige Getränke für zu viele Gäste eingekauft hat.
"Man hätte bedenken müssen, dass die Ariane 5 höhere Zahlen für die Flugdaten bietet, und dass man diese Zahlen auch wirklich im Bordcomputer abspeichern kann."
Der Fehlschlag kostete die Esa rund 500 Millionen Dollar. Doch die Weltraumagentur lässt sich nicht aufhalten. Sie behebt den Fehler, und am 30. Oktober 1997 startet die Ariane 5 erneut in Richtung Weltraum – diesmal mit Erfolg.